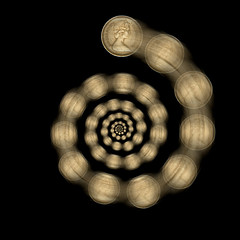Gläubige Menschen können ja mitunter sehr empfindlich reagieren, wenn schlecht über Gott (und alles, was sie mit ihm verbinden) geredet wird. In einer pluralistischen Gesellschaft, in der die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist, kommt das regelmäßig vor, und man muss lernen, mit Spott, Verdrehungen und Anfeindungen zu leben.
Ich findes es, ehrlich gesagt, schwieriger, damit zu leben, wie schlecht viele Gläubige über Gott reden. Nicht, dass sie gehässige Dinge über ihn sagen würden, ganz im Gegenteil. Sie sagen nur das gut Gemeinte so häufig gedankenlos, phantasielos und banal, dass es weh tut – so wie es allen leidlich musikalischen Menschen weh tut, wenn jemand schräg singt, oder wie das Quietschen von Kreide auf der Schultafel schmerzhaft sein kann. Vergangene Woche habe ich mich mit ein paar Menschen unterhalten, die von Gott und vom Reden etwas verstehen, und dabei bemerkt, es geht nicht nur mir so (dass ich gerade wieder mal David Bentley Hart lese, schärft den Kontrast ebenfalls).
Um richtig verstanden zu werden – mir geht es nicht um eine theologische Correctness oder um unnatürliche Gestelztheit im Reden. Mir ist auch bewusst, dass es erhebliche Unterschiede in Bildung, Eloquenz und Sprachgefühl gibt innerhalb der Christenheit. Aber manchmal wünsche ich mir jene Ehrfurcht vor dem Gottesnamen zurück, die darin besteht, ihn “nicht unnütz“ zu gebrauchen und die im Judentum dazu führte, ihn nicht mehr direkt auszusprechen.
Vielleicht ist es das (in diesen Fällen freilich gescheiterte…) Anliegen, von Gott auf „unfrommme“ Art zu reden, in einer Sprache, die auch für Menschen zugänglich ist, die nicht kirchlich sozialisiert wurden, das zu dieser Banalisierung geführt hat, denn sie betrifft viele, die sich irgendwie als „missionarisch“ verstehen. Vielleicht soll es die Alltäglichkeit der Gottesgegenwart unterstreichen, dass sie von einem Kumpel-Gott sprechen, der „überallhin mitgeht“, „immer dabei“ ist und der sich im Bedarfsfall (miese Stimmung, Ratlosigkeit etc.) bereitwillig nützlich macht. Ich glaube, dass die Bibel selbst da, wo sie von Freundschaft zwischen Gott und Menschen spricht, etwas ganz anderes meint als dieses übernatürliche Maskottchen. Das Gerede vom privaten Kumpelgott ist freilich längst nicht mehr unkonventionell oder „authentisch“, es hat einen hohen Grad von Stereotypisierung und Formelhaftigkeit erreicht. Es ist, um es anders zu sagen, zu einer festen Liturgie geronnen.
Der Kumpelgott ist ebenso eine Karikatur des lebendigen Gottes wie es sein Vorgänger, der Polizistengott, war, oder dessen Vorläufer und Verwandter, der National- und Stammesgott, der die Interessen einer bestimmten, klar umrissenen Klientel (z.B. des Abendlands oder der wahren Kirche) vertritt. Der Kumpelgott gibt keine Rätsel auf, er stellt mich im Leben vor keine zusätzlichen Herausforderungen, sondern er hilft mir auf Zuruf bei denen, die das übliche Streben nach Glück schon mit sich bringt.
Von mir aus soll jede und jeder im stillen Kämmerlein mit Gott so reden, wie ihr oder ihm der Schnabel gewachsen ist. Aber so, wie es peinlich ist, wenn Paare sich vor anderen mit albernen Kosenamen anreden, auf Kindersprache und -stimmchen umschalten oder andere Dinge tun, die hinter verschlossenen Türen nur ihrem eigenen Geschmack und Vorlieben unterliegen, so ist es auch beim Reden von und mit Gott, zumal in der Öffentlichkeit.
Ich glaube, Gott hat es verdient, dass wir gut von ihm reden. Ich glaube auch, dass der Maßstab für „gut“ nur der sein kann, dass wir alle unser Bestes geben und an die Grenzen unserer jeweiligen sprachlichen und geistigen Möglichkeiten gehen. Ich glaube außerdem, dass die Menschen, vor und zu denen wir mit und über Gott reden, das verdient haben. Und ich hoffe, dass die Spötter und Zyniker in Zukunft weniger Quatsch finden, den sie genüsslich ausschlachten können.
Zugegeben: Solche Überlegungen können zu einer gewissen Befangenheit führen. Wenn ich mir selber kritisch zuhöre und überlege, ob ich das gerade wirklich so sagen will, stockt die Sprache gelegentlich, zeitweise bleibt sie auch ganz weg. Das ist anstrengend, aber es legt sich wieder in ein paar Monaten. Kein Grund also, sich der Mühe zu verweigern. So lange das mit den eigenen Worten noch nicht so recht klappt, lässt sich die Zeit zum Lesen und Zuhören nutzen. Zum Beispiel bei Abraham Heschel, der schrieb:
Die Kraft des Glaubens liegt im Schweigen, und in Worten, die Winterschlaf halten und warten. Der Ausdruck des Glaubens muss als Überschuss aus dem Schweigen hervorkommen, als Frucht gelebten Glaubens und anhaltender Innigkeit. Theologische Bildung muss diese private Seite vertiefen, um eine tägliche Erneuerung des Inneren ringen, die Zutaten religiöser Existenz kultivieren, Ehrfurcht und Verantwortung.